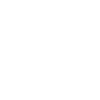04.09.2011 – Büchermarkt: Das Buch der Woche – Deutschlandfunk – Beatrix Novy, Hajo Steinert — – Details
Wolfgang Pehnt
Büchermarkt
04.09.2011
Aus dem literarischen Leben –
Das Buch der Woche
Wolfgang Pehnt:
»Die Regel und die Ausnahme»
(Hatje Cantz Verlag)
Bewusstsein für Architekturgeschichte
Buch der Woche: «Die Regel und die Ausnahme» von Wolfgang Pehnt
Von Beatrix Novy
Der Architekturhistoriker Wolfgang Pehnt hat sich über Jahre mit dem Grundsätzlichen der Architektur in seinen Essays beschäftigt. Sein neues Buch «Die Regel und die Ausnahme» nimmt sie auf und führt den Leser bis zur zeitgenössischen Architekturdiskussion. Dabei stellt er allzu homogene Epochenvorstellungen richtig.
»Öffentliche Diskussionen haben ihre eigene, unvorhersehbare Dynamik. Etwas wird zum Thema, beansprucht das allgemeine Interesse, dann wird die allgemeine Aufmerksamkeit es müde, über dasselbe Thema weiter nachzudenken, es gibt so viele andere konkurrierende Themen, die auf Erörterung warten. Es wird abgehakt und abgelegt, ohne dass sich etwas Entscheidendes geändert hätte.»»
Auch wenn Wolfgang Pehnt diese Worte auf die Tragik verfallender Kirchenbauten gemünzt hat: Sie passen auch zu seinem neuen Buch, das mit der Krankheit der schnellen Auf- und Abregungen so gar nichts gemein hat. Hier findet sich, gedruckt und in Sicherheit, auch einiges von den Architektur- und Städtebauthemen, die in den Medien sporadisch hochkochen. «Die Regel und die Ausnahme» versammelt Aufsätze aus Fachmagazinen, Tagespresse, Festschriften, einige sind noch aus den 90er-Jahren, aber dass 20 Jahre eben keine lange Zeit sind, das kann man hier lernen. Die Themen reichen weit: von der expressionistischen Architektur, mit der Pehnt seit eh und je sich beschäftigte, zu zeitgenössischen Architekturikonen, vom Bauhaus zur Denkmalpflege, vom Modeslogan Neue Einfachheit zur umstrittenen Rekonstruktion. Aber auch Goethes Gartenhaus kommt vor, eine kleine Geschichte der Weltausstellungen, und auch: «der Neufert». Also die «Bauentwurfslehre» von Ernst Neufert, ein Nachschlagewerk, das bis heute jedem Architekten ein Begriff zu sein hat, so komplett theorielos, dass man es einem Architekturkritiker von Rang gar nicht zumuten möchte. Und doch hat Wolfgang Pehnt auch «dem Neufert» einen Platz reserviert, mit seinen Abmessungen und Normen, Zahlenreihen und Grafiken, für Krankenzimmer, Kaninchenställe, Behördenflure, Schlafzimmer, Selbstversorgergärten, Versammlungssäle, Schießbahnen, Luftschutzräume, aus der Erwahrungswelt zentimetergenau in die Abstraktion allzeit gültiger Tabellen überführt.
»Sogar die Zeit, die Einbrecher beim Geldschrankknacken benötigen, wird geschätzt und die Konstruktion der Tresore darauf abgestellt.»
Aber auch der Neufert hat selbstverständlich sein tieferes Reservoir an historischen und ideengeschichtlichen Bedeutungen. Wie die Bedingungen seiner Entstehungszeit und der nachfolgenden Auflagen sind auch diesem Regelwerk seine Variablen, seine Ausnahmen eingeschrieben, ist es also ein Stück Kultur- und Sozialgeschichte geworden. Ställe für pommersche Gänse werden nicht mehr gebaut, auch Frauen brauchen heutzutage Platz im Büro, statt der Waschküche entsteht im Keller die Sauna. Der kleine Aufsatz ist ein stellenweise höchst witziges Beispiel dafür, wie Wolfgang Pehnt auch von den äußeren Bezirken der Architekturgeschichte her das Signifikante herausarbeitet. Wie er seinen Gegenstand um- und einkreist, die Seitenwege abschreitet, die diversen Beziehungen auslotet, ohne den Ausgangspunkt aus dem Blick zu verlieren. So wird eine Betrachtung zum Thema Tür, passenderweise an den Anfang des Buchs gestellt, nicht nur zu einer Reise durch die Geschichte von Drinnen und Draußen, Öffnung und Verschluss, Totenreich und Paradies; sie führt auch über die Postulate des Funktionalismus zur quasi türlosen, glastransparenten Moderne, zu Gebäuden, bei denen Türen zu trivialen Eingängen geworden sind, oder zu diesen schwellenlosen Ladenöffnungen von Boutiquen, die flanierenden Frauen täglich zum Shopping-Verhängnis werden. Die ganze Entwicklung führt zu einer provokanten Frage, die das Thema Tür weit übersteigt:
»Ist es demokratisch, die Menschen der Nuancen, Abweichungen und Besonderheiten zu berauben, ihnen die Unterschiede zwischen Preisgegebensein und Geborgenheit, Offenheit und Schutz zu nehmen?»
So, übers Grundsätzliche, nähert man sich der zeitgenössischen Architekturdiskussion, die Wolfgang Pehnt mit seinen Texten über die Jahre begleitet hat. Da ist die Auseinandersetzung mit der grassierenden Star- und Markenarchitektur: Sie deutet sich leise an im Kapitel «Schinkels Kuppel und Libeskinds Blitz», einer kunsthistorischen Exegese zu einem Architekturmotiv par excellence, der Kuppel. Die repräsentiert seit dem Altertum nicht nur das Ideale in der Form, sie kann auch reden: von Schutz und Überwölbung, von Weite und Himmelszelt. Dieser uralten Symbolhaltigkeit, derer sich auch noch ein seinerzeit moderner Baumeister wie Friedrich Schinkel im 19. Jahrhundert bediente, stellt Pehnt eine Figur aus unseren Tagen entgegen: den Libeskind-Blitz. Während Schinkel zum Bau des Alten Museums in Berlin ein allen verständliches Motiv verwendete, eben die Kuppel, erfand Libeskind für sein jüdisches Museum etwas nie Dagewesenes: den blitzförmigen Grundriss, der den Ruhm des Gebäudes schlagartig begründete.
»Die Architekturgeschichte konnte ihm, anders als Schinkel, keine ihrer alten Pathosformeln mehr an die Hand geben.»
Aber: Gerade im Vergleich der beiden Figuren offenbart sich ihre Unvergleichbarkeit. Die altbewährte Bauform Kuppel ist in erster Linie Architektur, der Blitz in erster Linie Bedeutung. Als Sinnbild von Zerstörung und Zerklüftung spricht er die Besucher des Jüdischen Museums direkt an. Libeskind leitete ihn aber auch von der Form eines Davidsterns ab, gewonnen aus bestimmten signifikanten Adressen auf dem Berliner Stadtplan. Andererseits hat Libeskind die vielzackige Form vorher und nachher für ganz andere Planungen verwendet. Pehnt leitet dieses «Beziehungsspiel von hoher Willkürlichkeit» ab aus dem Originalitätszwang, der ihm zugrunde liegt.
»Man wird weder Pluralismus noch Globalisierung, zwei Charakterzüge der Gegenwart, zurücknehmen können oder auch nur wollen. Aus dem einen ergibt sich das andere, eine enorme Ausweitung der Quellen und Repertoires und gleichzeitig eine Abnahme ihrer gesellschaftlichen Verbindlichkeit. Wo sich einer in dieser Pluralität bemerkbar, sichtbar machen will, muss er auf hohe Originalität setzen. Aber große Originalität – das ist das Dilemma – bedeutet auch erschwerte Mitteilung. Wer von den Stars hochindividuelle Überraschungen erwartet, kann ihnen nicht verbindliche Deutungen abverlangen. Denn Verbindlichkeit setzt Konvention voraus.»
Wo andere genervte Kommentare abgeben, weil Libeskind schon wieder irgendwo etwas Blitzförmiges gebaut hat, misst Pehnt lieber die Spanne der objektiven Bedingungen ab. Das Eifern ist nicht seine Sache, schrieb ganz richtig einmal die «Frankfurter Allgemeine». Mit einem Mangel an Position oder Meinungsfreudigkeit hat das nichts zu tun; aber die Zeiten, als Kunst- und Architekturhistoriker ein geschlossenes Bild vergangener oder ihrer eigenen Epoche entwerfen konnten, sind vorbei. Wenn Pehnt unsere Epoche vorstellt in ihrer Epochenlosigkeit, ihrem postmodernen Nebeneinander, ihrer Optionalität und Beliebigkeit, stellt er im historischen Rückblick auch immer wieder die allzu homogenen Vorstellungen richtig, die wir von vergangenen Epochen haben. Überall gab es zu einer Richtung auch die Gegenrichtung, brachte ein Zeitgeist seine Antagonisten hervor. Exemplarisch fächert Pehnt das auf am Expressionismus, der sich architektonisch in vielen sehr diversen, mitunter gegenläufigen Ausdrucksformen und gesellschaftlichen Positionen niederschlug, und seine Tentakel weit in die Zeit nach den 10er- und 20er-Jahren ausstreckte. Mit den Nachkriegsarchitekten Hans Scharoun und Gottfried Böhm verfolgt Pehnt diesen Expressionismus nach dem Expressionismus und findet das Phänomen wieder in der Gegenwart: in den unerhörten Formfindungen der Mega- und Medienstars, der Gehrys, Hadids, Calatravas. Sie können das Expressive endlich auf die Spitze treiben; die Grenzen, die früher Material und Konstruktion setzten, hat die Technik verschoben.
»Wenn heute ein Frank O. Gehry dramatisch bewegte Blechhäute über verzogene Stahlhäute wirft oder Betonfertigteile verformt, bedient er sich selbstredend des Computers. Der Computer hilft nicht nur als Zeicheninstrument, sondern als Produktionswerkzeug. Nur so können die verwegensten zeitgenössischen Architekturerfindungen realisiert werden, die Längen der Stahlrohrglieder berechnet oder die Gussformen der Betonelemente – jedes Teilstück ein anderes Format – gefräst werden.»
Aber was der Expressionismus am Anfang des 20. Jahrhunderts war: Ein Aufbruch, eine moralische Resolution gegen alles Akademische, Gekünstelte, für unmittelbaren Ausdruck und Gemeinschaft aller Künste, das kann es heute nicht mehr geben.
»Anders als der Expressionismus aus erster Hand ist der neue Expressionismus – wenn wir ihn denn überhaupt so nennen wollen – seit den späten 1950er-Jahren eine von vielen zeitgenössischen Spielarten, die heute Dekonstruktivismus, Zweite Moderne (oder ist es schon die dritte?), Neue Einfachheit oder Minimalismus heißen. Der Expressionismus aus zweiter Hand existiert schon sehr viel länger als sein Vorgänger. Er ist mit keinen weiteren sozialen oder religiösen Glaubensbekenntnissen verbunden. Er verpflichtet zu nichts und protestiert auch gegen nichts. Er will Gebäude als Designobjekte herstellen, die vor allem Sensation machen, zugunsten seiner Auftraggeber und notabene seiner Architekten. Die neuen Expressionisten mögen biografische Gründe oder eine künstlerische Überzeugung haben, so zu entwerfen, wie sie entwerfen. Aber ihr Vorschlag ist eine Offerte, die mit zahlreichen anderen konkurriert. Man kann sie wählen – oder auch eine andere.»
Und nicht anders ergeht es der klassischen Architekturmoderne, die sich doch als das Ende der Stilgeschichtebegriff. Ihre Vielfalt musste in den letzten Jahrzehnten erst nach und nach wiederentdeckt, freigelegt werden. Im Gegensatz zu einer weltweit verbreiteten Meinung war in den 20er-Jahren nicht alles Bauhaus, selbst unter den Lehranstalten in Deutschland gab es etliche, die in Sachen moderner Gesinnung dem Bauhaus das Wasser reichen konnten. Aber eine moderne Eigenschaft hatten die Weimarer und Dessauer den anderen voraus: ein erstklassiges Marketing. Im Kapitel über «Das Bauhaus und die Organisation seines Nachruhms» zeichnet Pehnt diesen Weg zum Meinungsmonopol nach. Doch auch das lange und weltweite Nachleben der Marke Bauhaus kann ihr postmodernes Schicksal nicht verhindern.
/»So sind Bauhausvillen, neu gebaute selbstverständlich, derzeit wieder vermehrt auf dem Immobilienmarkt vertreten, und bei manchen neuen Großobjekten im Stadtbild könnte ein Avantgardist der 1920er-Jahre Wiedersehensfeste feiern. Freilich müsste er auch bereit sein, an der nächsten Straßenecke das ganz und gar Andersartige zu tolerieren, eine Rekonstruktion aus der Plankammer der Retrokultur, den postmodernen Schnee von gestern, eine abermalige Volte des Dekonstruktivismus, ein Erzeugnis des Ökodesigns oder weiteres Experiment des Hightech. Die sektionale Dauerhaftigkeit des Bauhausstils ist mit dem Pluralismus konkurrierender Angebote bezahlt. Er existiert noch immer, aber muss viele andere neben sich dulden.»
Wirklich scharfe Töne schlägt Pehnt an beim umkämpften Thema Rekonstruktion. Der bündige Ausdruck für das, was früher verschämt, inzwischen immer offener geäußert wird: Wir wollen unser Stadtschloss, unsere Kirche, unsere ganze Altstadt wiederhaben.
»Wenn die Frankfurter Altstadtfreunde ihre Kampagnen führen, so wollen sie die Altstadt, wie sie gewesen ist, in alter Fachwerkseligkeit, aber möglichst nach Passivhausstandard gedämmt. Wenn sie Dresdner ihren Neumarkt wiederhaben wollen, so mit barocken Putzspiegeln und Gauben, wenn auch mit ein paar Tausend Quadratmetern Nutzfläche zusätzlich.»
Pehnt weiß wohl, dass der Wunsch nach der Schönheit und Heimatlichkeit alter Städte eine Reaktion ist auf die Zumutungen der Moderne. Und hat nicht das 20. Jahrhundert den Menschen zu viel Veränderungen in kurzer Zeit zugemutet; ist nicht der Wunsch, es mal für eine Weile gut sein zu lassen, mehr als verständlich? Gerade in Deutschland sind zwei Zerstörungswellen übers Land gegangen: erst der Krieg, dann die Renovierungs- und Abrisswut der 60er- und 70er-Jahre. Hier ist mehr passiert als in anderen, ebenso modernen Ländern, wo alte Städte bis heute unbehelligt stehenbleiben, deshalb fahren die Deutschen ja so gern hin. Aber auch, wenn Wolfgang Pehnt fragt:
»Könnte es sein, dass ein größeres Maß an Normalität gewünscht wird, weil das Leben Selbstverständlichkeit und nicht einen Ausnahmezustand nach dem anderen benötigt?»
Beharrt er doch auf den Tatsachen: Der Wiederaufbau alter Schlösser und Fachwerkhäuser bringt nichts zurück.
»Die Vielgestaltigkeit und Kleinteiligkeit der alten Stadt, ihr pittoresker Reiz, aber gelegentlich auch der Ausbruch in die autoritative Gebärde der Machtinstanzen, der Stadt- und der Landesöffentlichkeit, der Kirchen, Schlösser, Rathäuser, Tuchhallen, Speichergebäude, Torhäuser – das können die zeitgenössische Architektur und der zeitgenössische Städtebau schon deshalb nicht bieten, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse in ganz andere und abstraktere Größenordnungen hineingewachsen sind.»
Rekonstruktion erscheint umso aberwitziger, je mehr echte Zeugen der Vergangenheit überall verfallen oder gar abgerissen werden. Ohne den Begriff der Aura zu verwenden, klagt Pehnt ihren Verlust an: Auf der Strecke bleibt das Bewusstsein, dass ein Gebäude älter ist, vielleicht viele Jahrhunderte als man selbst. Das Bewusstsein für Geschichtlichkeit also. Im Kapitel über Berlin, den Abriss des Palasts der Republik und den geplanten Wiederaufbau des Stadtschlosses fordert Pehnt sarkastisch den Wiederaufbau noch ganz vieler verlorener Alt-Berliner Gebäude, denn: warum nicht?
»Herbeizitiert wird, was gefällt. So geht eine Generation, die es gewöhnt ist, ihre Informationen und ihre Unterhaltung auf digitalen Tastendruck abzurufen, mit jenem Genre um, das einmal als die materielle dauerhafteste und geistig traditionsfähigste der Künste galt, der Architektur. Ins Belieben der Gegenwart wird gestellt zu entscheiden, von welchem Zeugnis ihrer Vergangenheit sie sich endgültig verabschiedet und welches sie sich aufs Neue besorgen will. Darüber verkommen angesichts der schwindenden Mittel der Denkmalpflege vorhandene, gefährdete, eben noch zu rettende Geschichtsdokumente. Ihnen wäre mit einem Bruchteil jener Mittel zu helfen, die spektakuläre Reinkarnationen erfordern.»
Man könnte dagegen einwenden, dass andere Kulturen – und die Kulturen der Welt wachsen gerade zusammen – andere Maßstäbe fürs Authentische hervorgebracht haben: Ostasien zum Beispiel eine große Wertschätzung der perfekten Wiederholung des immer gleichen ehrwürdigen Alten in Kunst und Baukunst. Andererseits ist der Umgang mit Vergangenheit für uns nun mal direkt mit ihren baulichen Zeugnissen verbunden. Es ist das Glätten der Geschichte, das Ungeschehen-machen-wollen, das Pehnt nicht akzeptiert, auch nicht bei gewissen Neubauten. Wer sich schon immer allein fühlte, weil ihn Peter Zumthors hochgelobtes Kolumba-Museum in Köln nicht so überzeugte wie den Rest der Welt, wird sich über das Kapitel «Ein Ende der Wundpflege» freuen, in dem es um die richtige Art der Reparatur zerstörter oder verfallener Bauten geht. Wo Architekten sonst, seit sie Altes und Neues zusammenbringen müssen, die Fugen mehr oder weniger sichtbar machen, das Alte vom Neuen absetzen, überbaute Zumthor die kleine Nachkriegs-Kapelle von Gottfried Böhm, die jahrzehntelang die Kölner an den Krieg erinnert hatte. Und gab dem Museum eine Fassade, die in ihrer hermetischen Eleganz an nichts erinnert.
»Die Wunde soll zuheilen, endlich. Keine Risse mehr, keine Fehlstellen. Allem Fragmentarischen, das den Bauplatz und seine Umgebung bestimmte, hält er ein harmonisierendes Bild entgegen, fast triumphal. Kein Chaos mehr, keine Brüche, nichts Heterogenes, keine nach außen getragenen Konflikte. Der Krieg ging vor mehr als sechzig Jahren zu Ende, vergessen wir ihn.»//
Wolfgang Pehnts Buch ist mehr als eine Aufsatzsammlung. Aus den aktuellen und den allgemeinen Architekturfragen heraus rundet sich ein Bild. Wer von Architektur mehr wissen will, jedenfalls soviel, dass einem vor einem Sensationsbauwerk mehr einfällt als nur Ah! und Oh! ausrufen zu können, findet in diesem Buch das Rüstzeug dafür. Dass man als Preis dafür ab und zu mal ein Wort im kunsthistorischen Lexikon nachschlagen muss, ist nicht zu viel für eine sichere Grundlage, auf der eine oft affirmative Architekturkritik kritisch gelesen werden kann.
Wolfgang Pehnt: Die Regel und die Ausnahme – Essays zu Bauen, Planen und Ähnlichem
Verlag Hatje Cantz, 320 Seiten, 35 Euro
Die Themen des Buches reichen vom Bauhaus bis zur Denkmalpflege, von der expressionistischen bis zur zeitgenössischen Architektur. (Bild: AP)
SK-xxddhehi