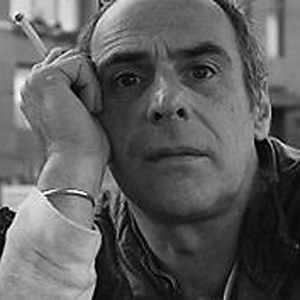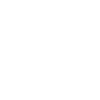19.02.2025 – News – taz-blogs – taz — – Details
Thomas Brasch
Zur Ästshetik des Widerspruchs und einer Literatur des Träumens bei Thomas Brasch — Thomas Brasch im November 1993
Mit seinem zu frühen Tod ist auch der Literatur, dem intellektuellen und politischen Streitraum, etwas verloren gegangen. Damit verbunden: Das Denken, Schreiben und Leben im Widerspruch. Wie keine andere ist Braschs Literatur durch eine radikal-zärtliche Ästhetik solcher Widersprüche gekennzeichnet.
Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit, Faschismus und Kommunismus, Wünschen und Fürchten, Gehen oder Bleiben, zwischen den Geschlechtern uvm. ziehen sich, so scheint uns, durch Thomas Braschs Leben. — Als Sohn jüdischer Emigrant*innen wurde er am 19. Februar 1945 im Exil in England geboren. Seine Mutter Gerda Brasch flüchtete aus Wien, sein Vater Horst Brasch wurde als Kind aus Nazideutschland nach England deportiert. Beide waren in Großbritannien für den Aufbau der FDJ aktiv und KPD Mitglieder. Der Vater: stellvertretender Minister für Kultur, die Mutter: Journalistin. Mit der DDR waren Hoffnungen auf einen kommunistischen Antifaschismus verbunden. Davon, dass die DDR das Träumen von einem anderen, nicht zugerichteten und gerechten Leben überhaupt erst erzeugt hat, und davon, dass dieselbe genau diese Träume am Ende durch Stagnation und Regress ertränkt hat, handelt Braschs Literatur. — Brasch kartographiert die widerstreitenden Zwischenräume. Er beschreibt das Eine mittels des Anderen, schreibt über das Gehen, um über das Bleiben zu sprechen. Er sagt immer ja und nein, fürchtet sich vor der Vergangenheit, um von der Zukunft zu träumen, schreibt über Männer, die eigentlich schwach sein wollen und Frauen, die stärker sind, als sie dürfen. — Die Sichtbarmachung des Widerspruchs sind Motor und Haltung seines Schreibens: — «Ich glaube, alles was Widerspruch ist, und alles, was in Frage stellt, ist produktiv, und das kann sich nicht damit erschöpfen, daß sich Gesellschaft in Frage stellt. Es muß beinhalten, daß ich beides in Frage stelle, und zwar immer wieder. Erst in dem Maß, als ich mich selber als ein gesellschaftliches Wesen oder, wie Marx schreibt, als ‹Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse‹, begreife, mich in Frage stelle, jede Art von Opportunismus, von Trägheit, zu der man neigt, zu der man neigen muß, in Frage stelle, ergibt sich daraus auch ein Vergnügen, Gesellschaft in Frage zu stellen. Ansonsten werde ich so oberlehrerhaft wie die, die die Gesellschaft bewahren wollen.» — Braschs literarisches Verfahren vermag es, gesellschaftliche Widersprüche überhaupt erst einmal als gesellschaftliche, also historisch gemachte Widersprüche sichtbar zu machen. Dann zwingt es uns als Leser*innen dazu, die Widersprüche auszuhalten. Versöhnung oder Aufhebung bieten seine Texte kaum an. «Statt zwingend Zusammenhänge zu konstruieren, ist man», sagt Insa Wilke in Text + Kritik, «aufgefordert, Verhältnissen und Übergängen nachzugehen – und auszuhalten, das Nebeneinanderstehendes sich nicht zu einem kohärenten Sinnganzen zusammenfügt.» — Kunstproduktion, das literarische Schreiben im Kapitalismus kann als Widerspruch für sich gelten. Was sonst wäre die Aufgabe von Literatur, die Gemachtheit dieser Widersprüche zu erzählen? Braschs Methode war die Verschärfung der Widersprüche: — «Er ist der Widerspruch der Künstler im Zeitalter des Geldes schlechthin, und er ist nur scheinbar zu lösen: mit dem Rückzug in eine privatisierende Kunstproduktion oder mit der Übernahme der Ideologie der Macht. Beides sind keine wirklichen Lösungen, denn sie gehen dem Widerspruch aus dem Weg und die Widersprüche sind die Hoffnungen. […] Meine Arbeit wird weiterhin darauf gerichtet sein, den Widerspruch auszuhalten und zu verschärfen.» — Das Widerspruchsverfahren erzählt im Ton des Einerseits-Anderseits.
Es ist das folgende «aber», das den Widerspruch genauso zusammenhält wie auseinandertreibt: — «Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin will ich nicht bleiben, aber die ich liebe will ich nicht verlassen, aber die ich kenne will ich nicht mehr sehen, aber wo ich lebe will ich nicht sterben, aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.» — Braschs Geschichten erzählen vom Aber, dass die Arbeitenden arm und die Faulen reich sind, dass Männer Krieger, Besitzer, Machthaber und Frauen Mütter, Köchinnen, Geliebte sein müssen. Und dann scheint genau in diesem Aber der Wirklichkeit immer auch eine Möglichkeit auf. Die Möglichkeit, dass es anders sein könnte. — In Brechts Gedicht «Lob der Dialektik» heißt es: «So, wie es ist, bleibt es nicht», in Heiner Müllers Artikel über Thomas Braschs Text Kargo: «Wie es bleibt, ist es nicht.» Hier wird nicht nur Brechts Tradition aufgegriffen, aber die einfache Utopie einer positiven Aufhebung der Verhältnisse negiert, sondern das Braschsche Kernmotiv des widersprüchlichen Realitätsprinzips besonders deutlich: Alles bleibt so, wie es nie war! — ASCHE UND DIAMANT — «Geh nicht weg, sagte sie.
Der blaue Himmel im Kino und die Welt die nicht mehr ist, wie sie nie war.» — Es bleibt die Realität widersprüchlich zu den realen Bedürfnissen und Leben der Menschen, es war nie so, dass das Reale und die Realität (im Kapitalismus) je deckungsgleich waren: «Arbeiten will / muß jeder». Braschs Antworten auf die Frage, warum überhaupt (Theater) Spielen in Zeiten des Kapitalismus lautet «[…] um nicht arbeiten gehen zu müssen / um Arbeit zu haben / […] um Mann und Frau zu sein zu gleicher Zeit […] um die Frage überflüssig zu machen: Warum spielen / um zu spielen/.» — Einen Text von Thomas Brasch zu lesen heißt, zu träumen und sich gleichzeitg zu fürchten. Es gibt keine Gewissheiten, auch in den Träumen nicht. So gibt es in seinen Texten oft mehr als eine Version der Geschichte und die erzählenden Protagonist*innen beschuldigen sich gegenseitig der Lüge. In seinem Buch Vor den Vätern sterben die Söhne erzählen sie sich fortwährend Geschichten und glauben sich nicht, zweifeln letztlich sogar daran, dass der Andere die Träume, die er träumt, wirklich geträumt hat: «Du hast dir diesen Traum Wort für Wort ausgedacht» — Wenn Träume am Maßstab einer objektiven Wahrheit gemessen werden müssen, müssen sie die Rekapitulation der bereits gelebten Gegenwart bleiben. Er schreibt: «[…] um die Träume von Angst und Hoffnung vorzuführen einer Gesellschaft, die traumlos an ihrem Untergang arbeitet.» Letztlich ist Braschs Schreiben also der verzweifelte Versuch, eine traumlose Gesellschaft zum Träumen zu reanimieren. Die abgeschlossene Zukunft, die abhanden gekommenen Träume und die Unmöglichkeit zu Schreiben, bringen Brasch (vielleicht) dazu, die DDR in Richtung BRD zu verlassen: — «Ich kann nicht machen, was du konntest.
Schließlich habt ihr um die schönen Häuser eine Mauer gebaut.
Wenn wir sie nicht gebaut hätten, wärt ihr jetzt alle drüben, wo es glitzert und funkelt.
Der Alte lehnte sich zurück.
Oder gerade nicht, sagte Robert. […] Von vorne anfangen in einer offenen Gegend.
Setz dich doch hin, sagte der Alte.
Ich weiß, schrie Robert weiter, das war alles schon da, das klingt alles pathetisch, das alles ist nichts Neues.
Wenn ich was Besseres wüßte, würde ich nicht hier stehen.» — Während man Brasch in der DDR nicht lesen wollte und in der BRD bereits die Rolle des Dissidenten für ihn vorgemerkt war, ringt er selbst mit dem eigenen Schreiben; mit der eigenen Sprache. In seinem Text Der Sprung – Beschreibung einer Oper resümiert er: — «Eine andere Sprache sprechen, eine, die nur der Sprecher versteht, hinter der er sich vollständig versteckt, hinter der ihn keiner entdeckt, die Sprache der Opfer und Täter zu einem gewalttätigen zärtlichen Gespinst vermischen, wie die der Männer und Frauen, der Irren und Kinder, der bleichen Feiglinge und steinernen Mumien, eine Sprache wie ein Tanz, der sich selbst genügt vor einem Orchester ohne Instrumente unter einem Himmel voller Geigen, verkleidet als Maschinengewehre, die Sprache einer sprachlosen Hauptperson sprechen lernen, der man nicht begegnet ist, außer auf dem Papier, auf dem Klavier, Ihre Schreie sprechen lernen.» — Brasch gibt jede Eindeutigkeit auf. Seine Sprache wird zu einem Schrei. Zum gewaltvollen Ausbruch der Sprachlosigkeit, die doch spricht, nur anders. Musikalisch vielleicht. Die Sprache einer «sprachlosen Hauptperson» lernen, bezeichnet hier den Versuch, überhaupt wieder eine Sprache (zurück) zu gewinnen. Es war jedoch nicht die DDR (allein), die Brasch seine Sprache verlieren ließ. Vielmehr war es die Eingliederung der ehemaligen DDR in die BRD. Das betonte Brasch abermals. Es war das endgültige Verschwinden eines gescheiterten Traums, den Brasch – wie viele andere – jedoch niemals selbst träumen durften. Nicht in der DDR, weil der Traum hier bereits fertig war und nicht in der BRD, weil er selbst – und mit ihm sein Traum – immer vor den biographischen Fakt seiner Ausreise aus der DDR gezerrt wurde. Im Jahr 1987 sagt er dazu in einem Interview: — «Die Beschreibung der Ohnmacht ist der Beginn ihrer Überwindung. Dabei wird mir bewußt, wie stark nach meinem Wechsel von einem deutschen Land in das andere an mich die Erwartung herangetragen wird, aus der hermetischen Kunstwelt herauszukommen und die Aufforderung formuliert wird, mich feuilletonistisch zu verhalten.» — So wird der Wunsch, sich hinter der eigenen, für andere unverständlichen Sprache zu verstecken, zum Versuch, die eigenen Träume zu bewahren. Das Schreiben wird zum Tresor, zur Möglichkeit, weiter zu träumen entgegen der Unmöglichkeit. — In diesem Sinne: Weiterschreiben. Trotzalledem! Denn: — «Wer schreibt der bleibt Hier oder weg oder wo Wer schreibt der treibt So oder so» — Masel tov, Thomas Brasch!
Dornröschen und Schweinefleisch — «Wer geht wohin weg Wer bleibt warum wo Unter der festen Wolke ein Leck Alexanderplatz und Bahnhof Zoo — Abschied von morgen Ankunft gestern Das ist der deutsche Traum Endlich verbrüdern sich die Schwestern Zwei Hexen unterm Apfelbaum — Wer schreibt der bleibt Hier oder weg oder wo Wer schreibt der treibt So oder so»
SK-news